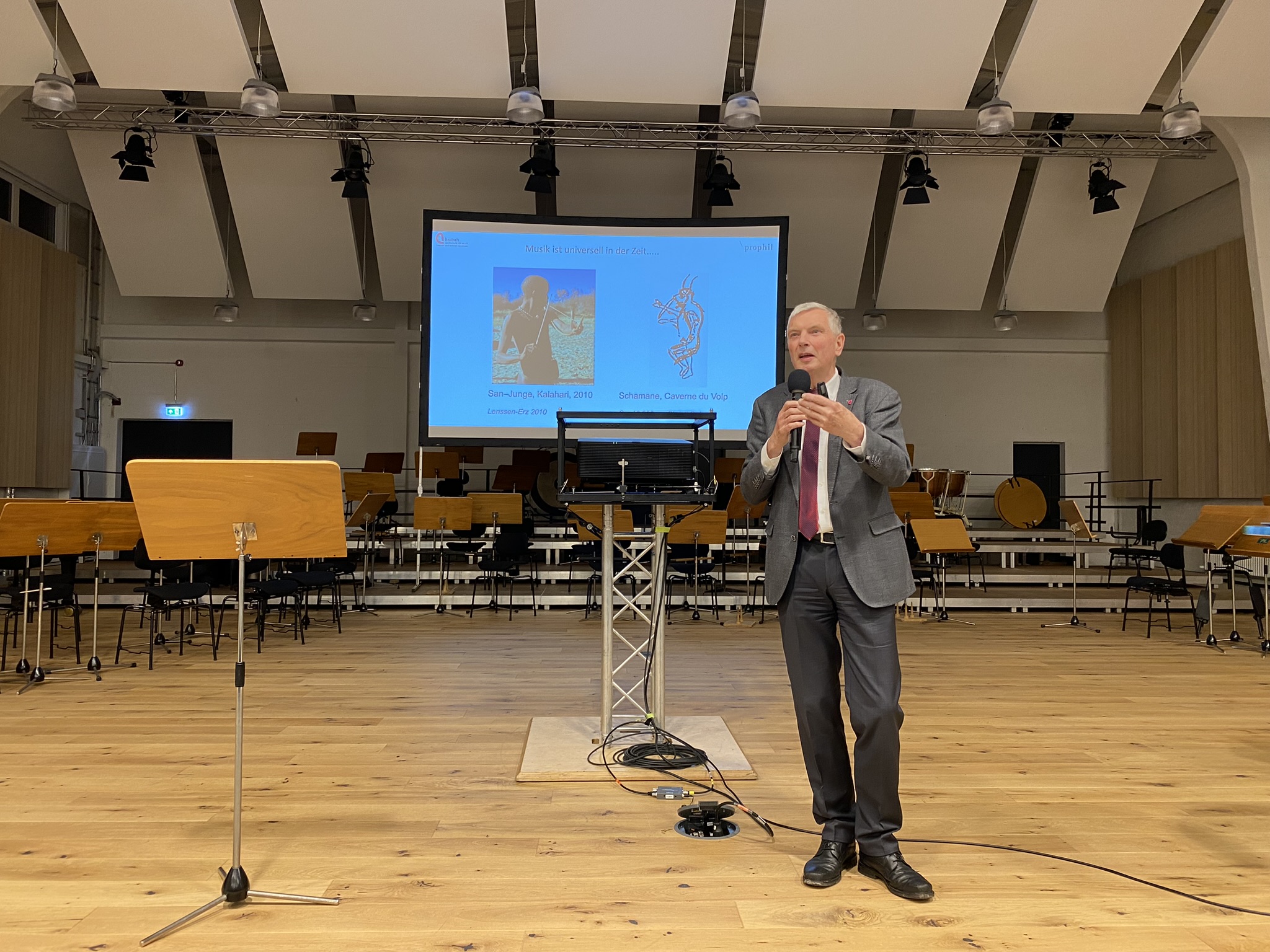Eine Probe der Bremer Philharmoniker in ihrem Übungsraum an der
Plantage in Findorff, exklusiv für prophil-Mitglieder. Musikerinnen und
Musiker im Alltags-Look. Chefdirigent Marko Letonja sitzt auf einem hohen
Stuhl, die Beine nach hinten verschränkt, gelegentlich springt er auf.
„Taktzahl 175“, sagt er und hebt gleich darauf zu singen an:
Jamparipam“. Und los geht’s. Takt 227. Und wieder singt der
Generalmusikdirektor zur Illustration des gewünschten Tempos. Diesmal
„Tarantarim, tarantarim“. Zuhörerinnen und Zuhörer sind fasziniert,
dass sie so hautnah die intensive Arbeit am vierten Philharmonischen
Konzert „Winterzauber“ verfolgen dürfen. Leseprobe nennt sich diese
erste Verständigung über einzelne Takte. Und es steckt wahnsinnig viel
Arbeit drin. Prophil-Mitglied Karla Götz hatte Gelegenheit für ein kurzes
Interview mit dem Chefdirigenten.
Herr Letonja, was bedeutet eine Probe mit Publikum für Sie und das
Orchester?
Marko Letonja: Probenbesuche wurden jahrelang unterschätzt. Manche
Musiker und Dirigenten sehen Proben als etwas ganz Intimes an und wünschen
keine Öffentlichkeit. Für mich ist die Idee, Proben zu öffnen, jedoch
ganz wichtig. Wir zeigen, wie wir ein Musikstück zusammen entwickeln.
Nicht nur den Zuhörern macht das Spaß, sondern motiviert auch das
Orchester und gibt mir inspirierende Gedanken. Es ist eine
Win-win-Situation. Eine wirklich gute Erfahrung war die öffentliche Probe
von Béla Bartóks Konzert für Orchester in der Glocke. 200 Interessierte
sind gekommen! Ich habe ein Mikrophon benutzt, weil ich ja mit den Rücken
zum Saal sitze, damit die Leute aber trotzdem gut hören können, was ich
den Philharmonikern sage. Es entsteht ja eigentlich eine unsichtbare Wand
zwischen Orchester und Publikum. Das ist einfach so. Wir müssen diese
unsichtbare Mauer durchbrechen. Das habe ich mir zur Aufgabe gemacht.
Und das gelingt mit öffentlichen Proben?
Unter anderem. Es gibt aber auch noch weitere erfolgreiche Formate. In
Straßburg haben wir bei einer Haydn-Sinfonie das Publikum zu den Musikern
auf die Bühne gesetzt, damit sie das Orchester hautnah erleben konnten.
Die Leute waren begeistert.
Das Publikum braucht ja auch Nachwuchs. Wie holen Sie junge Leute in
Konzerte?
Junges Publikum muss man erst einmal gewinnen. Die Bremer Philharmoniker
sind darin über lange Jahre erfolgreich und leisten eine ausgezeichnete
Arbeit. Alle Initiativen speziell für junges Publikum sind super, die
Musikwerkstatt, Proben für Schulklassen, Jugend-und Familienkonzerte
…
Muss man die Musik erklären?
Ja, auf leichtere Art und nach meiner Überzeugung immer aus der Musik
heraus. Vom Kern der Musik müssen wir ausgehen und mit Assoziationen und
Themen die Besonderheiten der Musikstücke hervorheben. Wichtig ist aber
immer das Prinzip: Zuerst die Musik.
Es ist Ihre erste Spielzeit in Bremen, zugleich sind Sie noch
Chefdirigent des Orchèstre Philharmonique des Strasbourg und Artistic
Director des Tasmanian Symphony Orchsetra. Auf welches Orchester
konzentrieren Sie sich?
Der Kern ist für mich Bremen. Aber wir wussten, dass 2018 ein
Übergangsjahr sein wird. In Australien bin ich nur noch selten. Straßburg
konnte ich nicht so einfach aufgeben. Wenn 110 Musikerinnen und Musiker in
einem offenen Brief schreiben: Sie sind unser 111. Musiker, das Publikum
mich zum Bleiben bewegen will, dann ist das schon schwer, sich loszueisen.
Von Anfang an war auch vertraglich klar, dass diese Spielzeit eine
Übergangsphase mit nur fünf Konzerten für mich sein wird. Aber im
nächsten Jahr mache ich schon meine erste Oper am Theater Bremen, den
Falstaff. Mein Platz ist hier.
Sie haben Bremen mal als eine stille Stadt bezeichnet. Wie meinten
Sie das?
Mein wirkliches Leben sind die Momente der Stille. Der allgemeine
Geräuschpegel in der Bremer Innenstadt ist niedriger als andernorts. Zum
Beispiel Mailand: Dort ist es so lärmig, dass ich das Fenster im Hotel
nicht öffnen kann. Ich muss es schließen und kriege keine Luft. Nicht nur
der geringe Stadtlärm fällt mir positiv auf. Die Stille im Konzertsaal
Glocke ist wunderbar. Da muss ich ein großes Kompliment an das Bremer
Publikum machen. Momente der Stille, in der Musik Generalpause genannt,
sind hier zu halten. Ich spüre das Publikum im Rücken und merke, wie es
förmlich den Atem anhält. Das hat mich schon vor zehn Jahren bei meinem
ersten Besuch in Bremen fasziniert.
Copyright Fotos: Harald Rehling